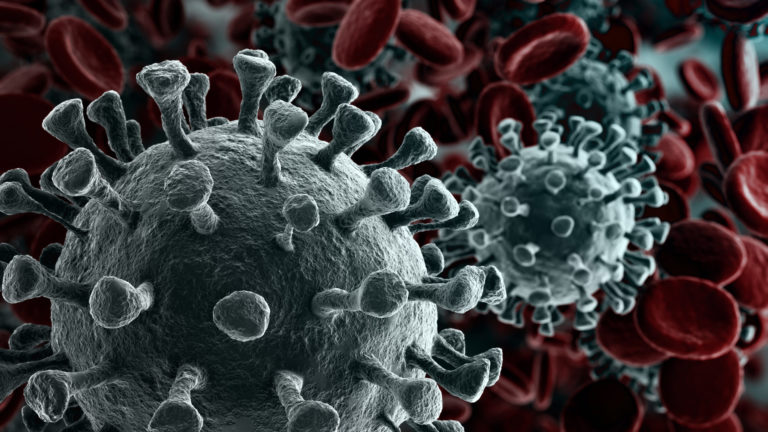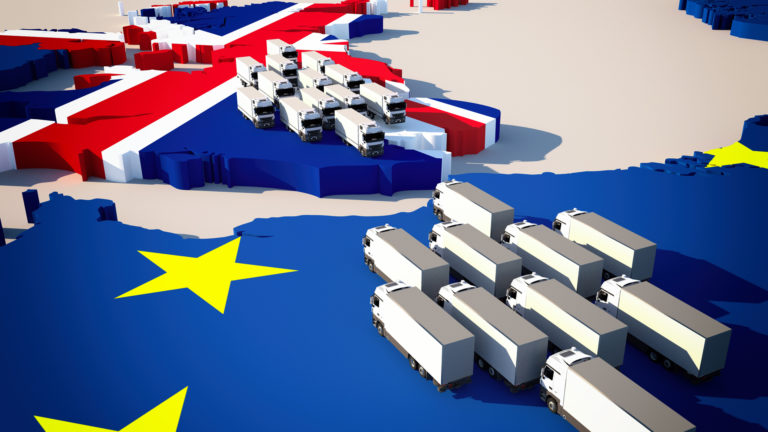BGH-Urteil zum Fernunterricht: Was Anbieter jetzt wissen und beachten müssen
Gut zu wissen: Dieser Blogbeitrag dient der Information und ist keine Rechtsberatung. Sollten konkrete rechtliche Entscheidungen oder Vertragsgestaltungen anstehen, empfehle ich, eine qualifizierte Rechtsberatung hinzuzuziehen.
In Zeiten, in denen Online-Trainings vermehrt – nicht nur in der Logistik oder der Arbeitssicherheit, sondern hoffentlich bald auch bei Fahrer-Weiterbildungen – Einzug halten, ist Rechtssicherheit für alle Bildungsträger essenziell. Auch ich überprüfe derzeit mein Angebot, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar, sondern bietet eine juristisch fundierte Einordnung des jüngsten BGH-Urteils und einen Ausblick auf die Entwicklungen – gerade vor dem Hintergrund, dass das geltende Gesetz den technischen Fortschritt nicht berücksichtigt.
Derzeit besteht eine hohe Unsicherheit bei allen Beteiligten: Bildungsträger, Teilnehmende und auch Plattformbetreiber suchen nach Orientierung. In sozialen Medien, Foren und Fachgruppen kursieren viele vermeintliche „Wahrheiten“, die teils auf Missverständnissen oder unvollständigen Informationen beruhen. Hinzu kommt, dass die Abgrenzung, was genau als „Sicherstellung des Lernerfolgs“ gilt, bislang nicht abschließend definiert ist. Hier wird vermutlich erst durch weitere Gerichtsentscheidungen oder gesetzliche Klarstellungen mehr Rechtssicherheit entstehen.
Aktuelle gesetzliche Regelung: Das Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG)
Das Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht (FernUSG) ist seit 1977 in Kraft (zuletzt geändert 2021, in Kraft seit Mai 2022). Es definiert Fernunterricht als eine vertraglich und entgeltlich vermittelte Form des Wissenserwerbs, bei der Lehrende und Lernende überwiegend räumlich getrennt sind und der Lernerfolg überwacht wird. Fernlehrgänge sind gemäß § 12 Abs. 1 FernUSG für jedes einzelne Produkt staatlich zuzulassen, etwa durch die ZFU in Köln.
Fehlt diese Zulassung, ist der Vertrag nichtig (§ 7 Abs. 1 FernUSG), und Teilnehmer können bereits geleistete Zahlungen zurückfordern. In der Praxis bedeutet das: Jedes Online-Produkt, das unter diese gesetzliche Regelung fällt, benötigt eine eigene Zulassung. Die Kosten für eine solche Zulassung übersteigen jedoch bei weitem den Verkaufspreis vieler Online-Kurse, was gerade für kleinere Anbieter eine erhebliche wirtschaftliche Hürde darstellt.
Das BGH-Urteil vom 12. Juni 2025 (Az. III ZR 109/24)
Der Bundesgerichtshof hat in diesem wegweisenden Urteil verbindlich entschieden:
- Die Anwendbarkeit des FernUSG auf Online-Coaching- und Mentoring-Angebote steht außer Frage – auch im B2B-Kontext.
- Der Begriff „Kenntnisse und Fähigkeiten“ wird weit ausgelegt – unabhängig vom Label wie „Coaching“ oder „Mentoring“.
- Räumliche Trennung liegt auch bei synchronen Online-Meetings vor, wenn diese aufgezeichnet und später abrufbar sind – sie gelten dann als asynchron.
- Eine Lernerfolgsüberwachung ist bereits dann gegeben, wenn Teilnehmende das Recht haben, Fragen zu stellen – etwa im Live-Meeting, per E-Mail oder in einem Forum, selbst wenn die Nutzung optional ist.
- Folge bei fehlender Zulassung: Der Vertrag ist nichtig, Rückzahlungen sind möglich, und ein Wertersatzanspruch des Anbieters ist nur unter engen Voraussetzungen durchsetzbar.
Wie können betroffene Anbieter nun agieren?
- Prüfung des eigenen Angebots
- Analysieren, ob das eigene Format als Fernunterricht im Sinne des FernUSG einzustufen ist.
- Zulassung beantragen
- Wenn die Kriterien erfüllt sind, ist der Weg über die ZFU-Zulassung der sicherste – auch wenn er mit hohen Kosten und langen Bearbeitungszeiten verbunden ist.
- Angebot anpassen
- Gestaltung so, dass es außerhalb des FernUSG fällt – z. B. durch reine Beratungsformate ohne festen Lehrplan oder ohne formalisierte Lernerfolgskontrolle.
- Verträge defensiv gestalten
- Klare Regelungen und Transparenz können das Risiko von Rückforderungen mindern.
Ausblick auf die rechtliche Entwicklung
Das FernUSG stammt aus der Vor‑Internet‑Ära und achtet technische Entwicklungen wie digitale Lernplattformen nicht angemessen. Aufgrund der Digitalisierung ist eine Modernisierung dringend erforderlich – auch im Koalitionsvertrag angekündigt (Stand: April 2025). Es ist davon auszugehen, dass Gesetzgeber und ZFU künftig auf zeitgemäße Rahmenbedingungen drängen werden – z. B. Anpassung der Zulassungsverfahren, klare Ausnahmen für bestimmte Formate oder technische Form der Lernkontrolle.
Bis dahin bleibt für Anbieter die Devise: rechtlich prüfen, transparent kommunizieren und flexibel anpassen.
#Fernunterricht #BGHUrteil #OnlineTraining #E_Learning #Rechtssicherheit #Bildungsträger #FernUSG #OnlineCoaching #DigitaleBildung #RechtUndBildung #LogistikTraining #Arbeitssicherheit #Fahrerweiterbildung #Bildung2025 #Gesetzeslage